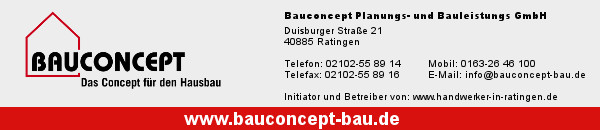Hösel/Lintorf. Rund 40 Menschen waren am 22. September dabei, als an der Kohlstraße 9 in Hösel der Stolperstein für Lieselotte Wevers verlegt wurde. Sie kam 1931 mit der genetischen Störung Trisomie 21 in Düsseldorf auf die Welt und wohnte den Großteil ihres kurzen Lebens in Ratingen in der Kohlstraße 3, jetzt Kohlstraße 9. 1941 wurde sie in die St.-Josef-Heil- und Pflegeanstalt nach Düsseldorf-Unterrath und 1943 über Umwege in den Kalmenhof ins hessische Idstein gebracht. Lieselotte Wevers verstarb dort elf Tage nach ihrer Ankunft am 22. September 1943.
In seiner Begrüßung hob Patrick Anders, Erster Beigeordneter und Kulturdezernent der Stadt Ratingen, auf die Aktualität dieser Verlegung angesichts des erstarkenden Rechtsradikalismus in der Gesellschaft ab. Er appellierte an die Anwesenden, dass dieser Stein für die Gesellschaft eine stete Mahnung sein müsse. Nie wieder darf ein solches Verbrechen geschehen. Anders zeigte sich tief bewegt angesichts des Schicksals von Lieselotte Wevers, die im Alter von zwölf Jahren ermordet wurde, nur weil sie eine kleine genetische Besonderheit hatte: Liselotte Wevers hatte das Down-Syndrom.
Begleitet wurde das Projekt der Stolpersteinverlegung von Schülerinnen und Schülern des Kopernikus-Gymnasiums Lintorf. Mit selbstgestalteten Plakaten wiesen sie ebenfalls auf das Schicksal von Lieselotte hin. Drei von ihnen fanden den Mut, ihre Eindrücke aus dem Projekt vorzutragen und einen Einblick in ihre Gefühle während der Beschäftigung mit dem Thema „Krankenmorde“ zu geben.
Nach der Verlegung des Steins durch einen städtischen Mitarbeiter ordnete Bastian Fleermann, Historiker und Leiter der Mahn- und Gedenkstätte Düsseldorf, die Ermordung Lieselotte Wevers in den historischen Kontext ein. Die ermordeten psychisch Kranken und behinderten Menschen seien lange Zeit eine vergessene Opfergruppe gewesen. Und das, obwohl sie in Düsseldorf zum Beispiel nach den Juden die zweitgrößte Opfergruppe war. Fleermann hofft, dass das Beispiel von Jutta Wevers, der Nichte von Lieselotte Wevers, die das Schicksal ihrer Tante recherchiert und auch öffentlich gemacht hat, Schule machen wird und andere Familien inspiriert, solche verdrängten Kapitel der Familiengeschichte aufzuarbeiten.
Jutta Wevers würdigte in einem Schlusswort die Arbeit der Schülerinnen und Schüler des Kopernikus-Gymnasiums. Sie wisse, dass sich diese aufgrund ihrer Beschäftigung mit dem Thema gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und Mord wenden würden.